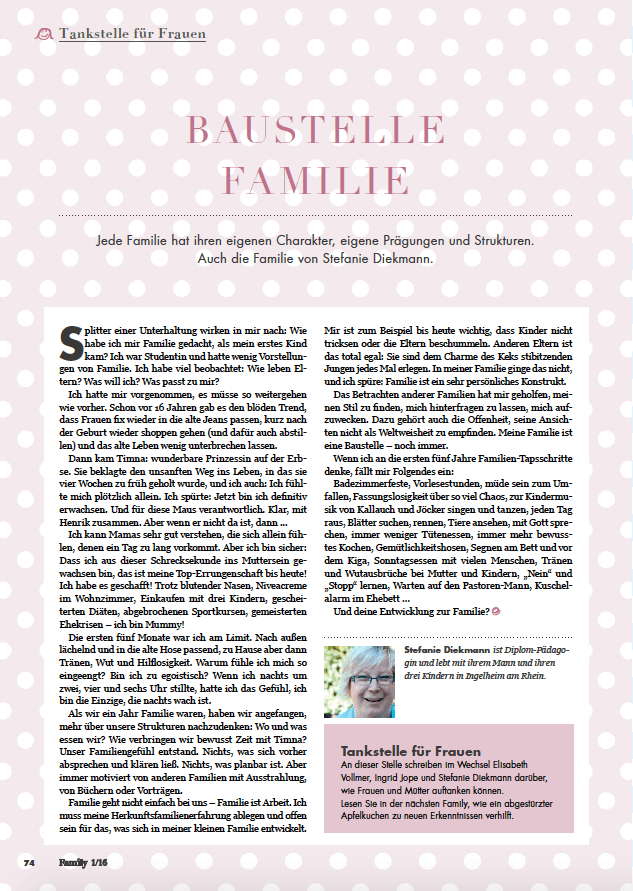Ein „normales“ Zuhause?
Ein Gastbeitrag von Cyra Maurer
Was mich in letzter Zeit immer wieder beschäftigt, ist unser Zuhause. Lange Zeit habe ich es als völlig normal empfunden: Wir wohnen als Familie in einem schmalen Reihenmittelhaus am Waldrand, mit ganz normalem Garten, in einem ganz normalen Ort. Also alles nicht weiter auffällig – dachten wir …
Doch seit mehreren Jahren sind wir Gastfamilie und haben unser Haus für Menschen aus aller Welt geöffnet. Und seit mehreren Jahren spazieren nun Menschen aus den verschiedensten Ländern hier ein und aus. Und plötzlich sehen wir unser Haus jedes Mal mit anderen Augen.
Da kommt der Koreaner und staunt: „Oh, so viel Platz! Und sogar mehrere Stockwerke! Wahnsinn!“ Und der Amerikaner denkt sich: „Nettes kleines Ferienhaus. Bei uns ist das Elternschlafzimmer so groß wie euer ganzes erstes Stockwerk.“
Beim Garten das Gleiche. Da kommt der Chinese und ruft erfreut: „Ihr habt einen echten Garten! Unglaublich! Ich war in meinem Leben noch nie in einem Haus mit Garten. Darf ich mal Rasen mähen? Das war schon immer mein Traum.“ Und dann kommt die Afrikanerin, deren Farmgrundstück halb so groß wie unser Dorf ist, und lächelt bei dem niedlichen Anblick von unserem „Grünstreifen“. Anschließend fragt sie, welche großen Tiere im Wald hinter unserem Haus leben (Elefanten, Löwen, Schlangen?), während die Japanerin bei jedem noch so kleinen Insekt laut aufschreit, weil es bei ihr in der Großstadt überhaupt keine Tiere gibt.
Innen denkt sich der Amerikaner: „Wow, nicht nur Badewanne, sondern sogar eine extra Dusche!“, während die Japanerin die beheizte Metallbadewanne für das tägliche Abendbad vermisst. Der Peruaner bewundert die Spülmaschine und den Backofen, der Chinese hält den Drehschrank für eine geniale Erfindung und liebt es zuzusehen, wie die Töpfe sich drehen.
Beim Essen geht es weiter. Der Amerikaner ist es gewohnt, außer Haus zu essen (Frühstück kaufen, im Auto essen. Mittagssnack kaufen, unterwegs essen.) und staunt, dass wir als Familie zu den Mahlzeiten täglich am Esstisch zusammenkommen. Der Franzose versteht nicht, warum wir immer „so schnell“ wieder aufstehen und nicht noch viel länger gemütlich sitzen bleiben wollen.
Die Amerikaner und Asiaten können nicht glauben, dass wir die Sommer ohne Klimaanlage überleben. Der Kanadier kann es nicht fassen, dass wir ohne Kamin im Winter nicht erfrieren.
Abends will die Afrikanerin aus Sicherheitsgründen am liebsten alles nach innen holen und ist irritiert, dass wir keinen elektrischen Zaun um das Grundstück und keine Alarmanlage im Haus haben. Und der Kanadier verliert unseren Haustürschlüssel und meint: „Ist doch nicht schlimm, oder?“, weil bei ihnen im Dorf nie eine Tür abgeschlossen wird. Ja, in Montana, USA, lassen sie sogar die Haustür extra weit offen, wenn sie in den Urlaub fahren, damit die Katzen in der Zeit immer rein und raus können. So friedlich kann es sein …
Und dann kommen die Flüchtlingsfrauen und die minderjährigen Jungs zum Deutschunterricht zu uns. Und sie erzählen von einfachen Hütten, die ihr Zuhause waren, von zerbombten Häusern, die sie verlassen haben, oder von den Containern, in denen sie jetzt leben und wahrscheinlich noch lange leben werden.
Und plötzlich wird mir bewusst: Unser Zuhause ist nicht normal. Wir leben in einem Paradies. Und wir haben so viel mehr an Platz und Wohlstand und Chancen, dass das gar nicht für uns allein gedacht sein kann. Oder?