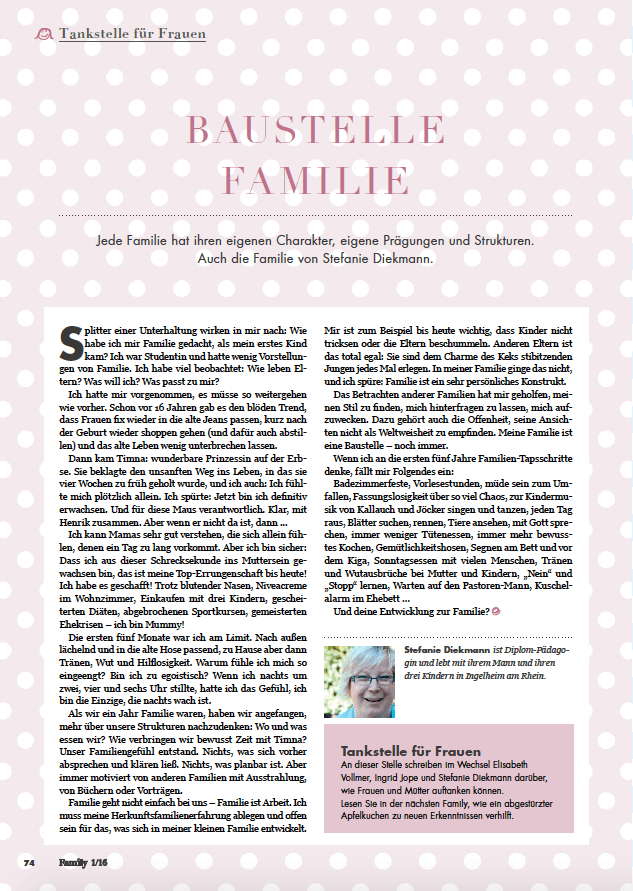Beten und arbeiten?
Elisabeth Vollmer reibt sich an einem bekannten Luther-Zitat.
Es gibt Sprüche, die begleiten mich durchs Leben. Einen davon fand ich lange gut und habe ihn dann und wann auch zitiert und weitergegeben. Jetzt habe ich mich von ihm verabschiedet und merke, wie entlastend und wohltuend das für mich ist. Ich rede von Martin Luthers Satz: „Bete, als ob alles Arbeiten nichts nützt, und arbeite, als ob alles Beten nichts nützt.“ Eigentlich soll dieser Satz ja motivieren – zu Gebet und Arbeit gleichermaßen. Aber für mich liest er sich, je länger desto mehr, wie das Lebenskonzept einer frommen schwäbischen Hausfrau auf dem direkten Weg in den Burnout. Er überfordert mich und ist ein Antreiber, dem ich gekündigt habe. Stattdessen möchte ich beten im Bewusstsein, dass ich als Christin in dieser Welt eine Aufgabe habe, die ich ausfüllen kann und darf. Dass ich ausgestattet bin mit Begabungen, die wichtig und es wert sind, gelebt zu werden. Und ich möchte arbeiten im Bewusstsein, dass ich das Meine, andere das Ihre und Gott das Seine tun kann und wird. So wie Paulus es im 1. Brief an die Korinther schreibt: „Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber ließ wachsen.“ Im Zusammenspiel mit Gott möchte ich meine Verantwortung in dieser Welt wahrnehmen. Arbeit und Gebet möchte ich nicht als getrennte Bereiche sehen oder gar gegeneinander aufrechnen. Stattdessen möchte ich leben (und das beinhaltet auch Arbeit und Gebet) in der Gelassenheit und Zuversicht, dass ich es nicht bin, die die Welt retten muss. Und das ist noch ein Punkt, weshalb ich mich an besagtem Zitat gerade so reibe: Es fordert mich doch quasi dazu auf, nicht zu leben, was ich glaube – nämlich, dass mein Gebet und/oder meine Arbeit fruchtbar sein kann. Neben dem Antreiber zur Höchstleistung, den ich dabei im Nacken spüre, ist es vor allem auch die innere Haltung, die mich verkrümmt, wenn ich sie einnehme. Wie schrecklich wäre es doch, wenn ich in der Überzeugung leben und beten müsste, als wäre all mein Arbeiten wirkungs- und wertlos? Und wie unfassbar anstrengend, wenn ich so arbeiten müsste, als hinge von meinem Einsatz alles ab? Ich bin wirklich froh, dass beides nicht der Fall ist! Stattdessen möchte ich im Vertrauen leben, was ich glaube und wovon ich überzeugt bin. Klingt ja so banal und gelingt mir doch immer wieder im Alltag so wenig … Ich bin davon überzeugt, dass der Sonntag ein Ruhetag ist, an dem es gut ist, nicht zu arbeiten, sondern aus der Ruhe heraus in die neue Woche zu starten. Aber dann war da neulich wieder einmal so viel los und ich habe mir überlegt, dass ein paar Stunden am Sonntagnachmittag den Arbeitsberg der Woche so weit abbauen könnten, dass ich dann eine ruhigere Woche habe. Und schon war sie dahin, meine Überzeugung, und ich drehte das Hamsterrad auch noch über den Sonntag hinaus. Keine gute Idee. Ich habe es direkt gespürt und meine Umgebung leider auch … Oder die Sache mit der Sorge um meine Kinder. Die buchstabiere ich seit Jahren durch. Immer wieder und wieder. Ich bin sozusagen Meisterin im Sorgenmachen. Denn: ja, ich glaube, dass Gott als guter Hirte meine Lämmchen im Blick hat und ihnen nachgeht. Aber dann lebe ich es so wenig. Wälze mich stattdessen in unruhigen Nächten hin und her und kreiere Horrorszenarien. Bis ich es dann wieder merke und mir eingestehe, dass ich ja nur das Mutterschaf und nicht der gute Hirte bin. Dass ich meines tun kann, aber nicht der Hirte sein kann und muss. Und das entlastet so ungemein. Irgendwie bin ich Luther doch dankbar für das Zitat, an dem ich mich die letzten Wochen so gerieben habe. Ich weiß jetzt besser, was ich glaube. Jetzt muss es mir nur noch gelingen, das zu leben.
Elisabeth Vollmer ist Religionspädagogin und lebt mit ihrer Familie in Merzhausen bei Freiburg.