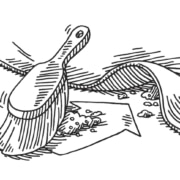Wir sind eins!
Es gibt nichts Schöneres, als wenn zwei Menschen ganz in ihrer Liebe zueinander aufgehen? Doch, das gibt es, denn symbiotische Beziehungen sind nicht der Idealzustand. Irgendwann fehlt nämlich das Gegenüber. Von Christina Glasow
Musst du heute wirklich zum Sport? Lass uns doch lieber einen gemütlichen Abend zusammen auf dem Sofa verbringen.“ Den Satz hört Laura nicht zum ersten Mal von Marc. Sie bekommt ein komisches Gefühl in der Magengegend. Ja, sie möchte zum Sport! Dort trifft sie ihre Freundin und fühlt sich fit. Sie weiß aber, wenn sie jetzt geht, kann es sein, dass sich Marc ihr gegenüber morgen den ganzen Tag kühl verhält. Wahrscheinlich wird er ihr vorhalten, dass ihr der Sport wichtiger sei als die Beziehung.
Den distanzierten Marc auszuhalten, fällt ihr schwer. Sie wünscht sich Harmonie. Gleichzeitig würde sie doch gerne zum Sport gehen, aber sie weiß, dass sie das mit schlechtem Gewissen tun wird. Beim letzten Mal entschuldigte sie sich schließlich dafür, dass sie dem Sport den Vorrang gegeben hatte. So richtig von Herzen kam diese Entschuldigung allerdings nicht. Seitdem ist die Stimmung zwischen ihnen wieder harmonisch – zumindest sieht das von außen so aus.
HAUPTSACHE HARMONISCH
Wenn die eigenen Bedürfnisse und Gefühle unterdrückt werden, damit die Beziehung harmonisch verlaufen kann, spricht man von symbiotischen Verhaltensmustern. Die Partner agieren nicht eigenständig, sondern in Abhängigkeit vom Verhalten des oder der anderen. Authentisches Verhalten wird unterdrückt, zum Beispiel aus Angst vor Verlust, Konflikten oder Ablehnung.
Solche Tendenzen gibt es, unterschiedlich ausgeprägt, wohl in jeder Beziehung. Das ist bis zu einem gewissen Grad und in bestimmten Situationen auch unproblematisch. Schwierig wird es, wenn einer oder beide Partner sich dabei nicht mehr wohlfühlen. Das wird wahrscheinlich irgendwann passieren, denn damit Symbiose funktioniert, bleibt nur ein sehr begrenzter Bewegungsspielraum, die Grenzen sind starr.
Doch jeder Mensch hat sein Leben lang den Drang nach Entwicklung und Entfaltung seines Potenzials. Entwicklung bedeutet Veränderung, Beweglichkeit, Flexibilität. Ein starres Beziehungssystem steht dann irgendwann im Weg. Wenn wir auf Dauer nicht sein können, nicht authentisch leben können, macht uns das unglücklich.
ERLERNTE STRATEGIEN
Aber wie kommt es eigentlich, dass wir manchmal nicht wir selbst sind? Wir alle sind geprägt von Werten und Erfahrungen, die uns in der Kindheit vermittelt wurden. Damals haben wir gelernt, welches Verhalten wir an den Tag legen sollten, damit unser Bedürfnis nach Anerkennung und Liebe gestillt wird. Ein Beispiel: „Wenn ich immer lieb und brav bin, werde ich gelobt.“ Niemand will immer nur lieb und brav sein, aber als Kind waren wir von unseren Eltern abhängig. Sie waren für die Erfüllung unserer Bedürfnisse zuständig, also haben wir uns entsprechend verhalten.
Anstelle unseres authentischen „Selbst“ haben wir also eine Variante unseres „Selbst“ entfaltet, das uns die Befriedigung unserer Bedürfnisse gesichert hat. Als Erwachsene stehen wir nicht mehr in dieser Abhängigkeit. Wir können frei über unser Leben bestimmen. Doch die altbewährten Strategien sind tief in uns verwurzelt. Sie funktionieren oft auch heute noch. Aber es kann passieren, dass ihre Anwendung uns auf Dauer ausbrennen lässt. Dass wir bitter und dünnhäutig werden, dass wir es als Druck und Stress empfinden, ein Selbst zu leben, das wir gar nicht sind. So setzt der Gedanke an den nahenden Sportabend und das damit wahrscheinlich verbundene Gespräch mit Marc Laura unter Stress, sie bekommt Herzklopfen. Doch wie kann ich überhaupt wissen, wer ich bin? Lässt sich ein authentisches Leben mit einer liebevollen Beziehung verbinden oder ist dann jeder auf seinem eigenen Trip unterwegs?
„DER MENSCH WIRD AM DU ZUM ICH“
Der Schweizer Psychoanalytiker und Paartherapeut Jürg Willi vertrat die These, dass sich Menschen nicht in mitmenschlicher Unabhängigkeit entwickeln, sondern in Beziehung zu anderen Menschen. Die Intensität einer Liebesbeziehung ist einzigartig und trägt somit die größte Chance auf Entwicklung in sich. Wer sieht mich sonst so ungeschminkt und auch mal unreflektiert oder unausstehlich? Kein anderer Kontext meines Lebens bietet so viele Interaktionen und damit die Möglichkeit für Austausch, ehrliche Kritik und Feedback.
Sehr schön zusammengefasst ist das in dem Satz von Martin Buber: „Der Mensch wird am Du zum Ich.“ Mit dem Du ist es wie mit einem Spiegel, der mir die Möglichkeit gibt, mich selbst zu sehen. Vielleicht mag ich nicht alles, was ich sehe, aber alles gehört zu mir dazu. Manches könnte ich ohne den Spiegel gar nicht erkennen.
Sofern ich einen guten Draht zu meinem Inneren habe und authentisch lebe, ist eine Beziehung also eine super Basis, auf der ich mich persönlich entwickeln kann. Lebe ich aber nicht authentisch, birgt die Intensität der Liebesbeziehung auch das Risiko, dass sich destruktive Dynamiken entwickeln, die eine persönliche Entwicklung kaum zulassen.
Trotzdem ist es ein Balanceakt, im Gleichgewicht zwischen dem Bedürfnis nach Eigenständigkeit sowie nach Beziehung und Harmonie zu leben. Differenzierung lautet hier das Zauberwort. Der Psycho- und Ehetherapeut David Schnarch formuliert es so: „Jeder wird im Laufe seiner Differenzierung eigenständiger und sogleich kooperationsfähiger.“ Differenzierung bedeutet also: in engen Beziehungen zu leben und dabei ein stabiles Selbstgefühl zu bewahren und mein Agieren nicht von den Reaktionen des Gesprächspartners abhängig zu machen.
Nur so bin ich überhaupt ein echtes Gegenüber, ein Spiegel, durch den sich wiederum meine engen Bezugspersonen weiterentwickeln können. Differenzierung ist also nicht das Gegenteil von Nähe, sondern sie ermöglicht in der Partnerschaft erst eine gesunde Version von emotionaler Nähe.
AUTHENTISCH(ER) LEBEN UND TROTZDEM ZUGEWANDT BLEIBEN
Wie sieht das praktisch aus? Zurück zu Laura und Marc. Seit der Pandemie haben sie angefangen, im Home-Office zu arbeiten. Laura sitzt am Esstisch, Marc eigentlich im Büro. Er findet die Vorstellung schön, gemeinsam zu arbeiten, also kommt er dazu und richtet seinen Arbeitsplatz neben Laura ein. So könnte man sich zwischendurch noch unterhalten und zusammen einen Kaffee trinken.
Laura spürt, wie sich ihr Magen zusammenzieht und sich ein Gefühl der Enge in ihr ausbreitet. Sie braucht Ruhe und Platz zum Arbeiten, sie arbeitet am liebsten alleine. Diese Situation fühlt sich für sie nicht gut an.
Was nun? Das wären die Tipps für Laura, und nicht nur für sie:
- Wahrnehmen und annehmen, was gerade in mir passiert.
- Mein Empfinden und meinen Wunsch gut kommunizieren in Form von „Ich-Botschaften“ (von mir selbst und meinem Empfinden sprechen, ohne den anderen anzuklagen). Don’t: „Du engst mich ein. Du kannst doch im Büro arbeiten.“ Do: „Ich fühle mich gerade unzufrieden und merke, wie Ärger in mir hochsteigt. Ich kann mich schlecht konzentrieren, wenn wir hier zu zweit sitzen und wünsche mir, während meiner Bürozeiten alleine zu arbeiten. Ich freue mich aber, wenn wir uns zur Kaffeepause treffen.“
- Konflikte als Chance betrachten, den anderen besser verstehen zu lernen, statt sie um jeden Preis zu vermeiden. Das gelingt durch „aktives Zuhören“: Nacheinander beiden Sichtweisen Raum geben, bis sich beide ganz vom anderen verstanden fühlen. Dabei ist das Ziel das Verstehen und auch Aushalten von unterschiedlichen Standpunkten.
- Trotz Unterschiedlichkeit zugewandt bleiben und im Austausch über Gefühle und Wünsche sein.
- Nicht den anderen verändern wollen, sondern erkennen, dass ich nur mich selbst (und damit auch die Beziehungsdynamik) ändern kann. Also die Verantwortung (nur) für mein Handeln übernehmen.
Wer symbiotische Beziehungsdynamiken durchbricht, erntet nicht unbedingt Beifall. Über ihre Gefühle und Bedürfnisse zu sprechen und mehr Raum einzufordern, ist Laura auch schwergefallen. Marc fühlte sich abgelehnt und ungeliebt. Das auszuhalten, war herausfordernd. Mit der Zeit erkannte er, dass sie sich nicht von ihm abgewendet hatte, sondern nur den für sie so wichtigen Freiraum beanspruchte.
Ihr Durchbrechen dieses symbiotischen Verhaltens ermöglicht auch ihm, sich weiterzuentwickeln. Er lernt, selbst mehr auf seine eigenen Bedürfnisse zu achten und entwickelt für ihn passende alternative Strategien, unabhängig von Laura. Er erlebt auch, dass Laura ihm diese nicht übel nimmt. Im Gegenteil, beide genießen es, Dinge alleine zu tun und dann auch wieder gemeinsam Zeit zu verbringen. Ganz freiwillig.
Christina Glasow arbeitet als Paarberaterin und psychologische Beraterin. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in Pulheim bei Köln. www.christinaglasow.de