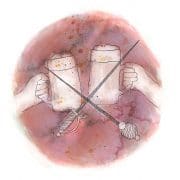Tabuthema: Alkohol- und Medikamentensucht bei Frauen
Überforderung und Traumata sind die häufigsten Ursachen für eine Alkohol- oder Medikamentensucht bei Frauen. Klinikleiter Gotthard Lehner erklärt im Interview, wie eine Abhängigkeit entsteht und wie betroffenen Frauen geholfen werden kann.
Ist Sucht bei Frauen im mittleren Alter ein häufiges Thema im Vergleich zu jüngeren oder älteren Frauen?
Das würde ich jetzt so nicht sagen. Sucht ist in jedem Lebensalter präsent. Die Grenzen zwischen den Altersstufen werden immer unschärfer. Die meisten Frauen, die wir behandeln, sind zwischen 36 und 60 Jahren alt. Die Zahlen sind bei den jüngeren und mittleren Frauen ziemlich konstant. Ältere Menschen hingegen haben häufiger Suchterkrankungen als jüngere Menschen. Zum Beispiel nachdem sie in Rente gegangen sind, weil sie dann ihr Leben wieder neu organisieren müssen. Früher mussten sich Frauen wieder neu definieren, wenn die Kinder aus dem Haus gegangen sind. Heute ist das durch die Berufstätigkeit allerdings kein so großes Thema mehr.
Wovon werden diese Frauen abhängig?
Nach Aussagen der Deutschen Hauptstelle für Suchtgefahren sind 4,5 Prozent der Männer und 1,7 Prozent der Frauen alkoholabhängig. Dann gibt es noch die Medikamentenabhängigkeit. Vor allem ältere Frauen, die häufig über einen längeren Zeitraum Psychopharmaka verordnet bekommen haben, werden medikamentenabhängig. In unserer Fachklinik für suchtkranke Frauen gibt es 60 Plätze. Wir haben immer zwei, drei Frauen mit einer „reinen“ Medikamentenabhängigkeit, bei vielen anderen ist die Medikamentenabhängigkeit mit einer Alkoholabhängigkeit kombiniert. Die Medikamentenabhängigkeit ist eher eine verborgene Sucht: Wenn ich morgens um zehn zu Ihnen komme und Sie um eine Tablette bitte, weil ich Kopfschmerzen habe, dann hoffe ich, dass Sie so nett wären, mir eine zu geben. Aber wenn ich zu Ihnen komme und Sie um zwei Schnäpse bitte, dann würden Sie – ohne mich näher zu kennen – wahrscheinlich meine Bitte ablehnen.
Ist die Medikamentenabhängigkeit also weniger auffällig?
Es wird geschätzt, dass etwa 1,5 bis 1,9 Millionen Personen in Deutschland medikamentenabhängig sind. Zum Vergleich: Laut Bundesgesundheitsministerium sind etwa 1,6 Millionen Menschen alkoholabhängig. Das ist ähnlich viel. Trotzdem werden bei der Deutschen Rentenversicherung deutlich mehr Anträge für die Behandlung alkoholabhängiger Menschen gestellt. Denn Medikamentenabhängigkeit lässt sich, wie schon gesagt, besser verstecken. Bis sie auffällt, dauert es oft lange. Frauen nehmen zum Beispiel auch im Alltag Medikamente, wenn sie ihre Periode haben. Manche gehen dann immer ganz naiv zum Arzt und lassen sich was verordnen. Und sagen: „Das hat mir der Doktor verordnet, dafür kann ich nichts.“ Sie hinterfragen nicht, was sie nehmen. Bei uns in der Suchttherapie kommt also mehr der Alkohol an.
Was sind denn die häufigsten Ursachen für eine Abhängigkeit?
Die Gründe sind immer so individuell wie die Person, jede Frau hat da ihre eigene Lebensgeschichte. Oft spielt das Thema Trennung eine Rolle, Partnerschaften, die, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr funktionieren. Bei Frauen ist es auch häufig eine Frage der Überforderung: Im Durchschnitt übernehmen sie heute immer noch, selbst wenn sie arbeiten gehen, einen Großteil der Hausarbeit. Auch die Pflege von Eltern wird meistens von Frauen übernommen. Die größere Belastung führt oft zur Überforderung. Und dann kommt abends, zunächst erst mal ganz harmlos, das Feierabendbier oder der Wein als Entspannungsmittel dazu. Mütter von kleineren Kindern treffen sich auch gern mal mit einer Flasche Sekt auf dem Spielplatz, für die gute Stimmung, während die Kinder im Sandkasten spielen.
Gibt es noch weitere Gründe?
Eine weitere große Gruppe, die zu uns kommt, sind traumatisierte Frauen, die sexuelle oder körperliche Gewalt erlebt haben und das nie therapeutisch bearbeitet haben. Erst heute Morgen haben wir über eine Patientin gesprochen, die bestimmt 10, 15 Jahre von ihrem Vater sexuell missbraucht wurde. Manche Frauen suchen sich immer wieder toxische Beziehungen und haben Partner, die sie schlagen. Das alles betäuben sie mit einem Suchtmittel. Diese Frauen kommen aber nicht gleich zu uns. Man muss zwei bis fünf Jahre regelmäßig trinken, bis man in eine Suchtmittelabhängigkeit gerät. Oft lässt sich das dann auch noch lange verstecken.
Wenn jemand merkt, dass er oder sie wahrscheinlich ein Suchtproblem hat – was sollte man als Erstes tun?
Zum einen sollte er oder sie Kontakt zu einer örtlichen Suchtberatung aufsuchen. Da bekommt man schnell und unkompliziert kostenlose Beratungstermine. Die nächste Stufe wäre dann eine ambulante Psychotherapie, 22 Gesprächstermine, die bei der Rentenversicherung beantragt werden müssen. Dabei hilft aber auch die Suchtberatungsstelle. Wird in der ambulanten Therapie gemerkt, dass die Situation sehr komplex ist und es helfen würde, die gewohnte Umgebung zu verlassen, dann wird zu einem Klinikaufenthalt geraten. Parallel rate ich immer dazu, Selbsthilfegruppen zu besuchen, die leisten wirklich sehr viel. Viele kommen allein durch den Besuch einer Selbsthilfegruppe, wie die Anonymen Alkoholiker oder das Blaue Kreuz, wieder aus ihrer Sucht heraus. In der Selbsthilfegruppe oder der Suchtberatung kann ich mich dann mit meinem Suchtverhalten auseinandersetzen und überlegen: Wie bin ich da reingerutscht und was muss ich in meinem Leben ändern? Kein Mensch nimmt sich mit 14 oder 15 Jahren vor: „Ich möchte mal suchtmittelabhängig werden.“ Irgendwann im Leben ist etwas passiert, was mich dazu gebracht hat, von der Autobahn meines Lebens herunterzufahren und die falsche Ausfahrt zu wählen.
Was können Angehörige oder Freundinnen tun, wenn sie bemerken: Hier gerät jemand gerade in eine Abhängigkeit oder ist schon abhängig?
Ich würde es als Erstes immer offen ansprechen und sagen: „Weißt du was, mir fällt auf, dass du immer viel trinkst. Könnte es sein, dass du ein Problem damit hast?“ Dann wird mein Gegenüber höchstwahrscheinlich sagen: „Nein, um Himmels willen, wie kannst du so was sagen? Ich bin doch keine Säuferin.“ Man kriegt erst mal einen Eimer Wasser ins Gesicht. Trotz allem halte ich das für den richtigen Weg. So wird der Person bewusst: Es ist aufgefallen. Sie wird sich dann erst mal zurückziehen. Als Freund oder Angehörige können Sie nicht mehr tun, als es anzusprechen. Sie können sie nicht zwangsweise zum Arzt schleppen. Näheren Angehörigen empfehle ich immer, eine Selbsthilfegruppe zu besuchen. Das ist wichtig, um festzustellen: Ich bin nicht der Einzige, den das betrifft. Auch die anderen haben den Eimer Wasser ins Gesicht bekommen.
Und wenn die Person auch langfristig alles abstreitet?
Dann kann ich vielleicht noch mal sagen: „So stelle ich mir mein Leben nicht vor. Da muss sich etwas ändern oder ich gehe.“
Was wäre dann die letzte Konsequenz als Partner? Einen Schlussstrich ziehen? Oder es aushalten?
Ich sage immer: „Drohen Sie mit nichts, was Sie nicht halten wollen.“ Auch die Angehörigen haben ein Recht auf ein zufriedenes Leben. Wir können nicht unser Leben weggeben, weil die andere Person einen Lebensentwurf gewählt hat, der für uns nicht akzeptabel und zerstörerisch ist.
Wie können Angehörige oder Freunde unterstützen, wenn jemand bereits in Therapie ist?
Wichtig sind die Angehörigengespräche während der Therapie. In denen sollte möglichst ehrlich das besprochen werden, was vorgefallen ist. Auch der Angehörige leidet ja. Nichts ist falscher, als nachher wieder eine heile Welt vorzuspielen. In der Klinik sage ich deswegen immer: Bringen Sie mir die Angehörigen. Lassen Sie uns miteinander sprechen, selbst wenn es wehtut. Begeben wir uns dann auf den Weg, dass das wieder gesunden kann. Leider erleben wir in der Klinik auch immer wieder, dass Partner sich dann trennen. Das engste Umfeld ist aber natürlich sehr wichtig in dieser Zeit. Überhaupt jede Form von Gemeinschaft. Wir haben bei uns in der Klinik eine Seelsorgerin, die die Frauen begleitet. Manche Frauen kommen bei uns auch zum Glauben. Und die Seelsorgerin überlegt dann: Welche Gemeinde kann ich ihnen nach dem Aufenthalt empfehlen? Wo gibt es Gemeinden, die auch Menschen ohne eine perfekte Biografie willkommen heißen?
Das ist eine gute Frage. Wie sollten Gemeinden Menschen mit Suchterkrankungen denn willkommen heißen?
Es braucht eine Kultur, in der auch Menschen, die nicht perfekt sind, die gescheitert sind und Narben mitbringen, willkommen sind. Das sind oft hochsensible Menschen, sie haben sehr genaue Antennen und spüren, ob sie gemocht werden oder nicht. Werden sie akzeptiert? Ist man beispielsweise bereit, Abendmahl nur mit Saft zu feiern? Am Ende sind es auch nur Menschen wie du und ich. Wir haben alle unsere Blessuren, die uns das Leben mitgegeben hat. Da kann der Glaube eine zusätzliche Kraftquelle sein. Erkenne ich für mich: „Ich bin eine von Gott geliebte Person“ – dann ist das eine wichtige Ressource, die mir hilft, wenn andere mich ablehnen.
Das Interview führte Sarah Kröger, Journalistin und Projektmanagerin.
Gotthard Lehner ist Leiter der Fachklinik Haus Immanuel in Thurnau (Oberfranken). Die Einrichtung hat sich auf die Behandlung von Frauen mit einer Alkohol- oder Medikamentenabhängigkeit spezialisiert. haus-immanuel.de