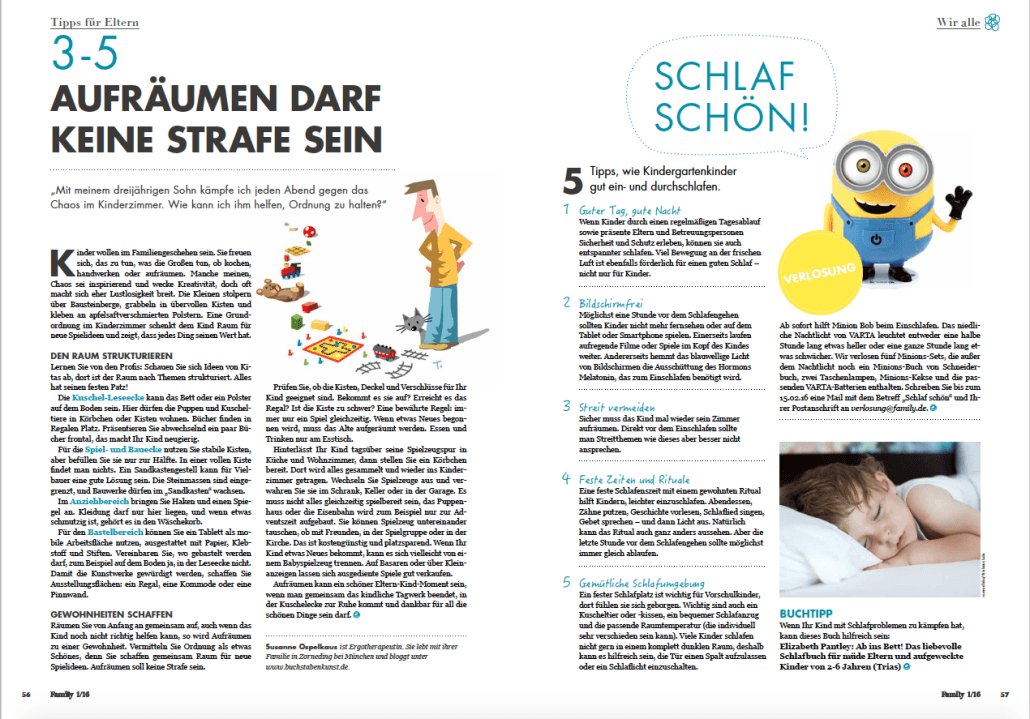Loslassen, was uns nicht guttut!
Weniger ist mehr, meint Tamara von Abendroth. Und sie bezieht das nicht nur auf Dinge, die wir besitzen. Auch in unserem Inneren sollten wir mal wieder aufräumen.
Zu Hause sollte ein Ort sein, an dem wir zur Ruhe kommen können. Doch oft ist der Ort, an dem wir zu Hause sind, mit zu vielen Besitztümern gefüllt, sodass das Auge und die Seele sich nur schwer entspannen können. Räume, Kleiderschränke, Schubladen sind viel zu vollgestopft mit Dingen, die wir schon seit Monaten nicht mehr angefasst haben. Wir leben in einer Welt des Überflusses und der Reizüberflutung. Die Dinge, die in den Schubladen verstauben, entziehen uns Energie, weil sie unser Leben zu voll machen. Gerade wenn Unordnung herrscht oder wir nicht zum Saubermachen kommen, fühlen wir uns schnell von unserem Besitz belastet.
Im Kinderzimmer türmt sich das Spielzeug. Die Kisten im Badezimmer sind voll mit unbenutzten Produkten. Im Schuhschrank liegen drei paar Sandalen nebeneinander. Getragen haben wir sie schon seit Jahren nicht mehr. Das Leben könnte einfacher sein, wenn wir regelmäßig entrümpeln würden. Denn je weniger ich habe, desto weniger Entscheidungen muss ich treffen. Wenn ich nur zwischen wenigen Lieblingskleidungsstücken wählen darf, trinke ich meinen morgendlichen Kaffee mit viel mehr Gemütlichkeit. Je weniger Chaos das Auge im Alltag vorfindet, desto einfacher kann die Seele zur Ruhe kommen.
Alles Äußere überträgt sich nach Innen
Wir sollten Seele, Körper und Geist immer wieder aufräumen, um ein zufriedenes, in Balance stehendes Leben zu führen. Das Leben selbst bietet uns dafür viele Möglichkeiten. Besonders innere Krisen fordern uns regelmäßig dazu auf: Kümmere dich um dein Innenleben, sonst gehst du innerlich zu Grunde. Überprüfe immer wieder deine Werte, deine Prioritäten, deine Beziehungen, und bleibe in Bewegung und Veränderung. Gott gibt uns durch biblische Gleichnisse und Geschichten immer wieder den Auftrag, uns von Dingen zu trennen, die uns nicht guttun. Gott rät uns, dass wir für ein gesundes Innenleben Dinge loslassen sollten, in denen kein Leben ist, in denen keine Barmherzigkeit und keine Wahrhaftigkeit stecken. Es braucht Mut und Weisheit, zu erkennen, von welchen Gedankenmustern, Verhaltensweisen und ungesunden Strukturen wir uns trennen sollten.
Diese innere Inventur funktioniert viel besser, wenn auch der Ort, an dem ich lebe, aufgeräumt ist. Und noch besser, wenn dieser aufgeräumte Ort nicht so voll ist. Denn alles Innere überträgt sich nach außen. Und alles Äußere überträgt sich nach innen. Wenn wir entrümpeln und uns von überflüssigen Dingen befreien, fällt es uns leichter, eine innere Inventur durchzuführen. In aufgeräumten Räumen können wir fokussierter denken. Wir können viel Zeit sparen, wenn wir weniger Dinge suchen müssen. Weniger Dinge bedeutet mehr Zeit für meine Beziehungen und auch für mich.
Wenn du das Gefühl hast, dass der Ort, an dem du lebst, zu voll ist, dann ist Ausmisten ein guter Start für mehr Raum für die Seele. Und noch besser: Möglichst nur noch wenige ausgewählte Dinge anschaffen.
Das heißt besonders bei Kleidung zu überlegen: Brauche ich das dritte Paar Schuhe wirklich? Kann ich die Lebensmittel, die ich kaufe, wirklich alle aufessen? Braucht es noch dieses Duschgel? Sind die anderen wirklich schon aufgebraucht?
Und wo fange ich an?
Es gibt ein paar hilfreiche Tipps, wie ich mein Leben entrümpele und dafür sorge, dass es auch nicht so schnell wieder vollgestopft wird.
- Es fällt uns nicht leicht, uns von Dingen zu trennen. Man könnte den Gegenstand ja irgendwann noch mal gebrauchen. Da hilft die Erinnerung: Wir benutzen 20 Prozent unserer Sachen 80 Prozent unserer Zeit. Was ist mit den anderen 80 Prozent? Wurden diese über ein Jahr nicht benutzt? Können die weg? In jedem Zimmer wird Schublade für Schublade mit diesem Blick aussortiert. Ein großer Karton steht dabei neben dir. Alles, was im Karton landet, wird verschenkt, verkauft oder kommt ins Recycling. Wir in Berlin legen die noch guten Gegenstände vor die Tür. Andere Menschen freuen sich noch daran.
- Wenn die wenige Zeit einen daran hindert, mit dem Aussortieren anzufangen, weil einem der Berg so riesig vorkommt, dann könnte man sich vornehmen, einen Monat lang fünf Dinge am Tag auszusortieren. Oder eine Schublade, ein Kleidungsfach pro Woche etc.
- Es hilft, Dinge nach Themen zu sortieren und in kleine und große Kisten einzuordnen und diese dann zu beschriften. Gerade im Kinderzimmer ist das eine großartige Möglichkeit, um Kinder beim Aufräumen zu unterstützen. Alle Kuscheltiere in einen Sack, alle Puppensachen in eine Kiste. Für Krimskrams gibt es nur eine Kiste. Wenn die voll ist, muss etwas weg, um neuen Dingen Platz zu schaffen.
- Was ist mit den Lieblingssachen, die seit vielen Jahren nicht mehr angefasst wurden, aber so warme Erinnerungen in einem hervorrufen? Jeder von uns in der Familie hat dafür eine „Erinnerungs-Kiste“, wo diese Dinge ihren Platz finden. Dadurch verteilen sich die alten Mixtapes, das erste Hard Rock Cafe-T-Shirt, die handgeschriebenen Briefe nicht überall in der Wohnung, sondern sammeln sich an einem Ort.
- Wir verschenken zum Geburtstag oft Aktionen und keine Gegenstände mehr. Auch die Freunde unserer Kinder, die oft schon alles haben, freuen sich riesig über die Kino-Gutscheine, über den gemeinsamen Badebesuch, über die Einladung in den Zoo. Gleiches gilt für unsere Freunde. Nichts geht über eine Einladung zu einem selbstgekochten Dinner. Ganz nach dem Motto: Collect moments, not things.
Tamara von Abendroth arbeitet in der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in Berlin.