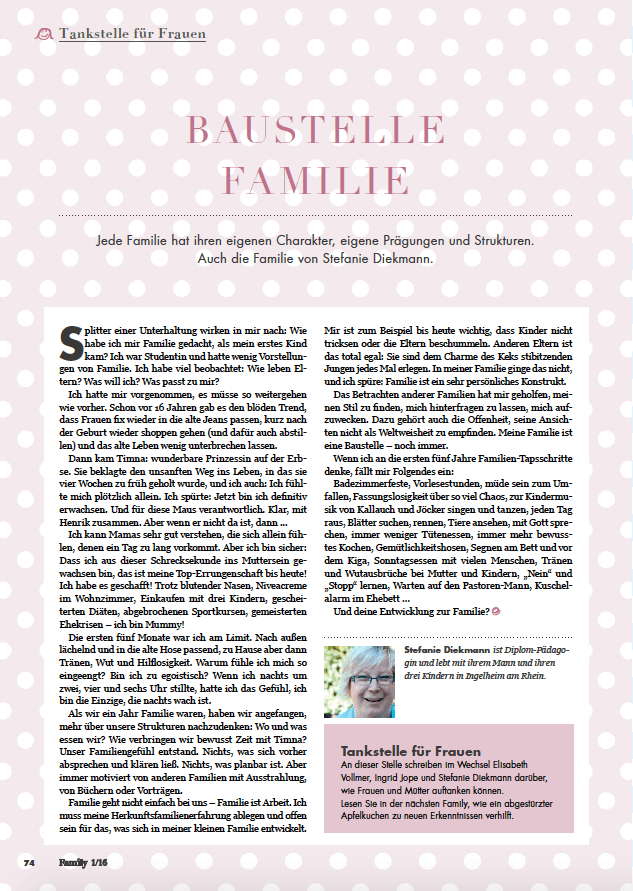Shit happens
Was ein gestürzter Apfelkuchen alles auslösen kann. Von Elisabeth Vollmer.
Ich hatte grade einen richtigen Flow und fühlte mich supergut! Vor dem Gottesdienst hatte ich die Idee, meinen Eltern einen spontanen Besuch abzustatten. Das machen wir selten, so ganz ohne Anlass. Aber irgendwie passte es grade rein. Und schließlich werden meine Eltern älter, und wer weiß, wie lange wir einander noch haben. Mein Mann war auch dafür, und so knetete ich vor dem Gottesdienst noch schnell einen Mürbeteig zusammen. Nach dem Gottesdienst waren dann auch unsere Teens wach und erstaunlicherweise willig, sich dem Spontanbesuch anzuschließen. Das bewog mich dazu, den geplanten gedeckten Apfelkuchen noch mit einer Vanillecremefüllung aufzupeppen. Die von meinem Mann geliebten Mandelsplitter vervollständigten das köstliche Werk.
Ich war also, wie gesagt, so richtig im Flow, als ich auf dem Weg war, das duftende Gebäck auf die Terrasse zum Abkühlen zu bringen. Wie es dann genau passierte, entzieht sich meiner Erinnerung (Verdrängung? Schock?). Jedenfalls schaffte ich es, mit einem Kuchen den maximalen Sauereifaktor zu erzielen. Das Parkett, der Teppichboden, die Balkontür und nicht zu vergessen meine Jeans (Aua! Heiß!): alles voll. Nur ein kleiner Rest befand sich noch in der Form. Mein Flow verwandelte sich im Sturzflug in einen Abgrund. Ich wusste nicht, ob ich heulen oder schreien sollte. Es waren nicht vor allem die Sauerei und der nicht mehr vorhandene Prachtkuchen, die mir zu schaffen machten. Es war das peinlich-kindische Gefühl, dass das so nicht fair war. Dass ich so sehr das Gefühl gehabt hatte, dass jetzt alles genau so richtig ist – und dass Gott dann doch bitte dafür hätte sorgen können, dass mir diese Form nicht aus den Händen fällt.
Glücklicherweise passiert mir solch ein Kuchen-Missgeschick sehr selten. Aber das Gefühl, dass ich mein Bestes gebe und das Resultat dann trotzdem unterirdisch sein kann, kenne ich leider auch aus anderen Alltagssituationen. Ich weiß: Das Leben ist keine berechenbare Matheaufgabe. Meine Illusion, dass bei optimalem Input zwangsläufig auch ein entsprechender Output die Folge sein müsste, hält sich trotzdem hartnäckig – und manchmal stimmt es ja auch. Aber, wie eine Freundin sagt: „Shit happens“. In jedem Leben, immer wieder, auch in meinem. Das ist ärgerlich, aber normal – und kein Anlass, mich oder Gott in Frage zu stellen. Und so ist mir dieser „Trümmerkuchen“ Anlass geworden, wieder neu Gelassenheit darin zu üben, dass das einfach so ist. Meine Jeans ist inzwischen gewaschen. Balkontür und Parkett waren schnell wieder sauber, mit dem Teppichboden war es etwas kniffliger …
An besagtem Sonntag hat mein Mann jedenfalls den Kuchen vom Boden weitgehend abgekratzt. In einer Schüssel haben wir ihn zu meinen Eltern mitgenommen. Wir hatten einen richtig schönen Nachmittag zusammen. Der Kuchen war so lecker, wie er vor dem Unfall aussah. Eigentlich gab es gar keinen Grund, mich in den emotionalen Abgrund zu stürzen. Shit happens – und das ist ganz normal!
 Elisabeth Vollmer ist Religionspädagogin
Elisabeth Vollmer ist Religionspädagogin
und lebt mit ihrer Familie in Merzhausen
bei Freiburg.