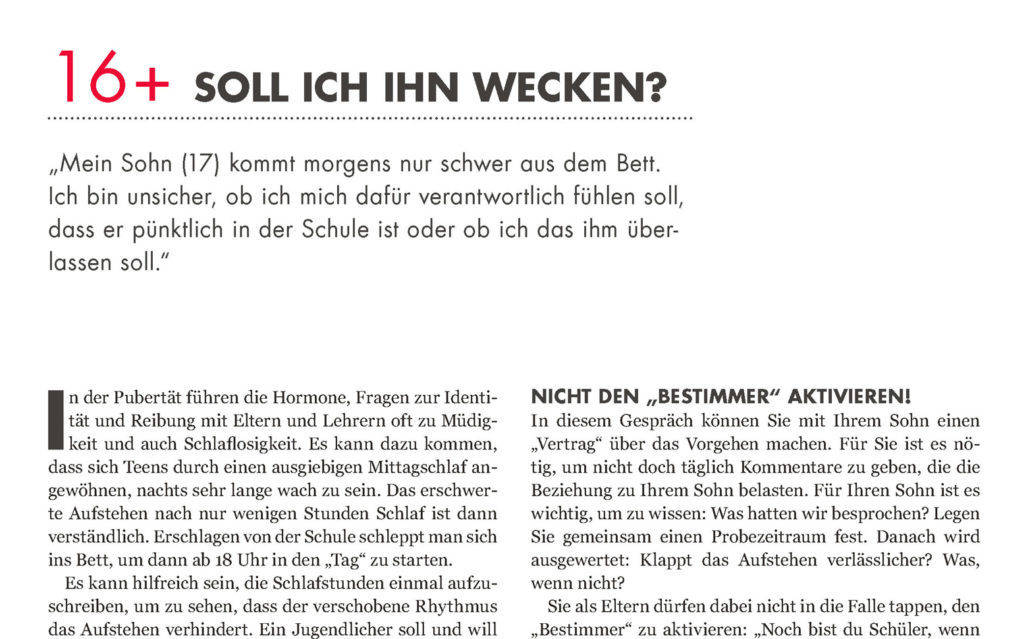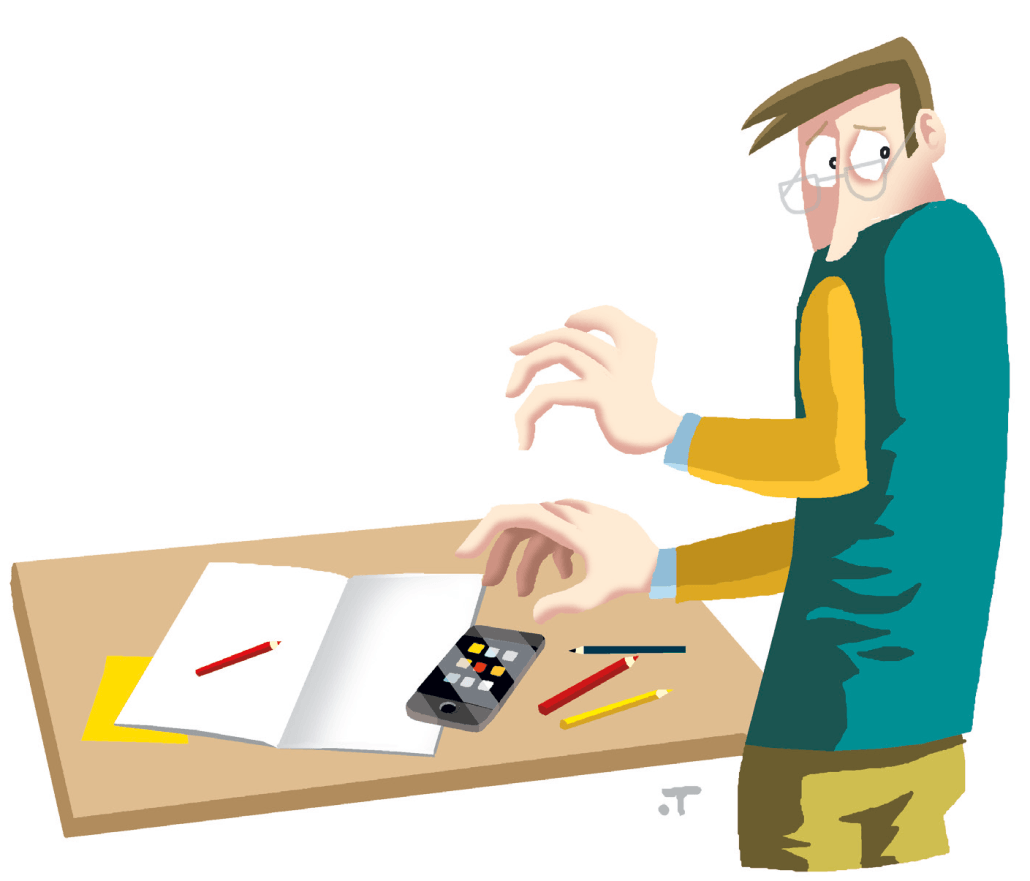Beim Konflikt helfen?
„Mein Sohn (25) engagiert sich als Trainer im Fußballverein. Nun gibt es einen heftigen Konflikt mit dem Vorsitzenden des Vereins, den ich gut kenne. Soll ich versuchen zu vermitteln? Oder sollte ich mich lieber raushalten?“
Spontan würde ich als Erstes sagen: raushalten! Schließlich handelt es sich ja um erwachsene Menschen – jedenfalls dem Alter nach. Aus meiner eigenen Tätigkeit als Trainer und als Mentor unserer Vereinsvorstände (Jugend und Senioren) weiß ich aber auch, dass die Kommunikation in Vereinen ausbaufähig ist. Manchmal sind auch die Beweggründe für Konflikte vielfältig und haben oftmals mit versteckten Interessen zu tun, die nicht öffentlich gemacht werden und auch nicht immer leicht zu erkennen sind. Unter bestimmten Voraussetzungen könnte es also schon sinnvoll sein, sich am Gesprächsgang zu beteiligen.
Klären Sie Ihre Rolle!
Wichtig in dem Zuge ist, dass Ihr Sohn dies nicht als Bevormundung empfindet, weshalb Sie meiner Meinung nach zunächst mit ihm das Gespräch suchen sollten. In diesem Gespräch sollten Sie folgende Fragen klären:
Will er, dass Sie an der Klärung beziehungsweise am Gesprächsprozess beteiligt sind?
Wenn ja, in welchem Maße – als direkt Beteiligter in den Gesprächen, als Ratgeber, als Mediator …?
Wäre es für ihn okay, dass Sie mit dem Vorsitzenden generell über den Konflikt reden – eventuell auch nur, um Ansichten zu spiegeln und für Verständnis und Klärung zu werben?
Gibt es Alternativen, die zu einer Klärung beitragen könnten, etwa externe Berater, Mediatoren, Ansprechpartner vom Verband oder Vereinsmitglieder, die großes Vertrauen im Verein genießen und als ausgleichende Persönlichkeiten bekannt sind?
Nicht in den Rücken fallen!
Ebenso könnten Sie Ihrem Sohn anbieten, gemeinsam die möglichen weiteren Verläufe des Konflikts mal zu durchdenken. Stellen Sie sich die Frage: „Was wäre, wenn …?“ Beachten Sie: Die Entscheidung über Ihre Rolle und Ihre Aufgabe(n) in dieser Kontroverse obliegt einzig Ihrem Sohn!
Wichtig ist meines Erachtens vor allem, dass Sie Ihrem Sohn nicht – gefühlt – in den Rücken fallen, zum Beispiel indem Sie hinter seinem Rücken agieren oder ohne sein Wissen mit dem Vorsitzenden sprechen. Selbst wenn der Filius im Unrecht wäre, würde eine Parteinahme zugunsten des Vorsitzenden Ihr familiäres Verhältnis schädigen. Verhalten Sie sich daher möglichst neutral – auch gegenüber dem Vorsitzenden. Das A und O ist Transparenz gegenüber Ihrem Sohn und die Vermittlung Ihrer Wertschätzung und Ihres Vertrauens ihm gegenüber!
Tim Linder ist Pastor der Freien evangelischen Gemeinde Bochum-Ost und Co-Trainer der A-Jugend des SV Langendreer 04.
Illustration: Sabrina Müller, sabrinamueller.com